Die Langzeitbelichtungsfotografie stellt interessante Herausforderungen dar, deren Lösung viel Übung und Geduld erfordert. Jeder Aspekt erfordert oft sorgfältige Überlegungen und mehrere Versuche, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Unsere Grundlagen der Langzeitbelichtungsfotografie bieten ein grundlegendes Verständnis für das Thema. Aufbauend auf dem vorigen Leitfaden geht dieser Artikel näher auf häufige Probleme und Herausforderungen ein, die bei der Aufnahme von Langzeitbelichtungen bei Tageslicht auftreten.
Sofern nicht anders angegeben, wurden die Bilder in diesem Artikel zugeschnitten und nur minimal angepasst (nur Helligkeit und Kontrast, keine lokalen Anpassungen, Farbkorrekturen oder Objektentfernung).
Inhaltsübersicht
Ein wichtiger Aspekt bei Langzeitbelichtungen ist die Qualität der Filter. Billige Filter sind oft aus Kunststoff, was zu Farbstichen und einer schlechteren Bildqualität führen kann. Hochwertige Filter von namhaften Herstellern sind zwar teurer, bestehen aber aus optischem Glas und beeinträchtigen die Farbgenauigkeit nicht.
Es gibt zwei Haupttypen von Filtern: Einschraubfilter und rechteckige Filter. Rechteckige Filter, die an einem Filterhalter befestigt werden, bieten den Vorteil, dass sich die Position von Verlaufsfiltern mit neutraler Dichte anpassen lässt. In letzter Zeit wurden magnetische Filter als Alternative zu Schraubfiltern und -haltern auf den Markt gebracht, allerdings geht bei diesen Filtern die Bequemlichkeit mit der Haltbarkeit einher, da Magnete mit der Zeit an Kraft verlieren.
Langzeitbelichtung zu hell oder zu dunkel
Die Wahl der richtigen Belichtungszeit für ein Bild hängt von der Tageszeit, dem Motiv und den technischen Einstellungen ab. Eine zu kurze Belichtungszeit kann dazu führen, dass Elemente nicht unterschieden und fließende Bewegungen nicht erfasst werden, während eine zu lange Belichtungszeit das Bild überbelichten kann. Darüber hinaus ist die Wahl des ISO-Werts von entscheidender Bedeutung und sollte auf ein Minimum beschränkt werden, da längere Belichtungszeiten deutlich mehr Rauschen verursachen können als typische Bilder.
Die folgenden fünf Bilder veranschaulichen, wie die Belichtungszeit das Gesamtbild an einem bewölkten Tag beeinflusst. Nur die Belichtungszeit wurde angepasst, und die Bilder wurden nicht durch Nachbearbeitung verändert.





Die Reziprozität in der Fotografie beschreibt das umgekehrte Verhältnis zwischen Lichtdauer und Lichtintensität, die einen Sensor erreichen. Die Hälfte der Lichtmenge für die doppelte Dauer ergibt die gleiche Belichtung. Deshalb führt die Verdoppelung der Belichtungszeit bei gleichzeitigem Schließen der Blende um eine Stufe zum gleichen Belichtungswert. Bei der Filmfotografie tritt bei sehr kurzen (unter 1/10.000 Sekunde) oder langen (über eine Sekunde) Belichtungszeiten ein Effekt auf, der als Reziprozitätsfehler (Schwarzschild-Effekt) bezeichnet wird.
Einfach erklärt, beschreibt der Reziprozitätsfehler, dass der Film bei abnehmender Lichtintensität weniger lichtempfindlich wird, was bei sehr kurzen oder langen Belichtungszeiten auftritt. Wenn die Filmemulsion nicht genügend Zeit hat, um bei schwachem Licht richtig belichtet zu werden, führt dies zu unterbelichteten Bildern und möglichen Farbverschiebungen. Jedes Filmmaterial hat unterschiedliche Reziprozitätseigenschaften. Zur Berechnung der endgültigen Belichtungszeit empfiehlt es sich, das Datenblatt des Films zu konsultieren, um den Faktor zu ermitteln, um den die gemessene Zeit für ein korrektes Ergebnis angepasst werden muss. Dieser Faktor wird entweder in Form von Blendenwerten oder sogenannten p-Werten angegeben. Die Belichtungszeit oder Blende muss entsprechend dem entsprechenden Blendenwert angepasst werden, während für p-Werte die Formel xp (wobei x die gemessene Zeit ist) zur Berechnung der angepassten Belichtungszeit verwendet werden sollte. Bei Filmen, bei denen diese Werte nicht bekannt sind, kann ein p-Wert von 1.33 angenommen werden. In den Datenblättern der Filme ist auch angegeben, ob ein Filter erforderlich ist, um die Farbverschiebung bei langen Belichtungszeiten auszugleichen, und es wird eine maximale Belichtungszeit empfohlen.
Das Reziprozitätsfehler ist nur bei Film ein Problem. Wenn mit Digitalkameras aufgenommene Langzeitbelichtungsbilder dunkler erscheinen, liegt das höchstwahrscheinlich an geringfügigen Schwankungen des ND-Werts des Filters. Viele stärkere Filter haben eine Fehlerspanne in Bezug auf die Lichtmenge, die sie durchlassen. Dieser Fehler muss bei der Berechnung der Belichtungszeit berücksichtigt werden, um ein richtig belichtetes Bild zu erhalten.
Details und Stabilität
Durch einen größeren Blendenwert (Verwendung einer schmaleren Blende) wird die Lichtmenge, die den Sensor erreicht, verringert, wodurch eine längere Belichtungszeit möglich wird. Paradoxerweise kann jedoch die Verwendung einer zu kleinen Blende aufgrund der Beugung zu einem Verlust von Details führen. Kurz erklärt: Beugung entsteht, wenn sich Lichtwellen beim Durchgang durch eine kleine Öffnung ausbreiten und miteinander überlagern. Diese Interferenz macht das Bild weicher und verringert die Schärfe, anstatt die Schärfentiefe zu erhöhen. Das Auftreten von Beugungseffekten hängt von der physikalischen Größe der Blende ab. Kameras mit größeren Formaten sind im Allgemeinen weniger von Beugungseffekten betroffen als Kleinbildkameras, so dass sie bei kleineren Blenden eine bessere Bildqualität bieten. Alternativen zur Erhöhung der Blendenzahl sind die Verwendung eines stärkeren ND-Filters, eine niedrigere ISO-Einstellung oder das Abwarten, bis sich die Lichtverhältnisse ändern.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich die Beugung auf ein Bild auswirkt. Es handelt sich um zwei Bilder in Originalgröße, die zur genaueren Betrachtung in einem neuen Tab geöffnet werden können, sowie um drei Nahaufnahmen.





Das Stapeln von zu vielen Filtern wird nicht empfohlen, da dies die Bildqualität beeinträchtigt. Das Licht, das durch mehrere Glasschichten fällt, wird zunehmend gestreut, was zu Unschärfe und Detailverlusten führt. Durch das Stapeln von Filtern wird die Dicke des Aufbaus erhöht, was bei Weitwinkelobjektiven zu mechanischen Problemen wie Vignettierung führen kann.

Zwischen dem Filter, dem Filterhalter und dem Objektiv ist eine dichte Abdichtung erforderlich, um Streulicht zu vermeiden. Das Erscheinungsbild von Streulicht kann je nach Belichtungszeit und Brennweite variieren, wobei Streulicht bei breiteren Objektiven stärker auftritt. Bei klassischen DSLRs sollte auch der Sucher abgedeckt werden, da direktes Licht zu Farbstichen und Kontrastverzerrungen im Bild führen kann. Während dies unter normalen Bedingungen kein Problem darstellt, kann es bei Langzeitbelichtungen häufig auftreten, selbst wenn der Sucher durch den Spiegel verdeckt ist.


Viele Objektive und neuere Kameras verfügen über ein integriertes Bildstabilisierungssystem, das bei längeren Verschlusszeiten hilft, Verwacklungen zu reduzieren. Die Bildstabilisierung ist zwar nützlich, muss aber deaktiviert werden, wenn die Kamera auf einem Stativ montiert ist. Wenn sie eingeschaltet bleibt, kann das System auch dann im Hintergrund arbeiten, wenn sich die Kamera während einer langen Belichtung nicht bewegt, was zu einer leichten Verschiebung der Objektivelemente oder des Kamerasensors und damit zu unerwünschten Unschärfen führt, wie im folgenden Bild zu sehen ist.

Oben - keine Bildstabilisierung, unten - die Stabilisierung führt zu Unschärfe durch leichte Verschiebungen während der Belichtung
Die Verwendung eines Fernauslösers und die Spiegelvorauslösung sind wichtig, aber für lange Belichtungszeiten nicht unbedingt erforderlich. Bei sehr langen Belichtungszeiten sind die anfänglichen Vibrationen, die durch die Bewegung des Spiegels, den Verschlussmechanismus oder durch leichtes Drücken des Auslösers verursacht werden, im Allgemeinen unbedeutend. Ein Zwei-Sekunden-Selbstauslöser sollte ausreichen, um mögliche Unschärfen zu vermeiden.
Die Stabilität ist ein weiterer entscheidender Faktor bei der Langzeitbelichtung. Es ist wichtig, dass die Kamera auf einem stabilen Stativ oder einer stabilen Oberfläche steht. Bei Wind kann das Anbringen zusätzlicher Gewichte am Stativ helfen, Bewegungen zu minimieren und Instabilität zu vermeiden. Außerdem kann das Abnehmen des Kameragurts das Risiko verringern, dass der Wind winzige Verschiebungen verursacht, die zu unscharfen Bildern führen.
In instabilem Gelände ist es am besten, Stativspitzen zu verwenden, um das Stativ besser zu sichern. Um zu verhindern, dass ein Stativ im Sand einsinkt und verrutscht, werden CDs unter die Stativbeine gelegt, um das Gewicht gleichmäßiger zu verteilen.
Hot Pixel entstehen, wenn der Sensor überhitzt. Unter normalen Aufnahmebedingungen ist dies in der Regel kein Problem, aber bei hohen ISO-Einstellungen oder bei Langzeitbelichtungen kann der Sensor überhitzen, was dazu führt, dass einzelne Pixel im Bild hervorstechen. Auch tote und festsitzende Pixel können sich bei Langzeitbelichtungen bemerkbar machen, insbesondere auf weichen Oberflächen des Bildes. Viele Kameras bieten eine Funktion zur Rauschunterdrückung, mit der diese Pixel während der Aufnahme entfernt werden können. Dazu muss jedoch die Belichtungszeit verdoppelt werden, da die Kamera unmittelbar nach der ersten Belichtung ein separates dunkles Bild aufnimmt, um das Rauschen und die Hot Pixel zu subtrahieren.
Staub auf dem Sensor macht sich bei kleinen Blenden bemerkbar und wird durch die gleichmäßigen Texturen bei Langzeitbelichtungen noch deutlicher. Dieser Staub ist unvermeidbar, da er oft beim Objektivwechsel in die Kamera gelangt. Viele Bildbearbeitungsprogramme bieten automatische Lösungen für die Staubentfernung bei der Nachbearbeitung an, und auch mit den Klon- und Heilungswerkzeugen in Photoshop lässt sich der Staub entfernen.
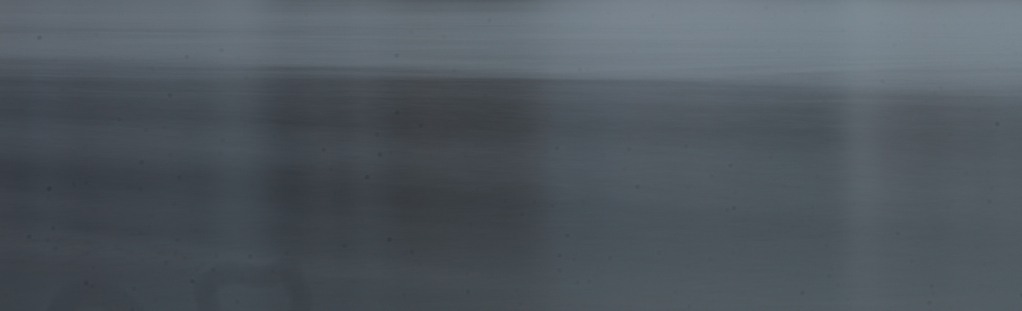
Während einer Langzeitbelichtung kann es zu weiteren, unvorhergesehenen Problemen kommen, die noch nicht behandelt wurden. Diese können jedoch in der Regel durch Neuberechnung, Neueinstellung und Wiederholung der Aufnahme behoben werden. Anders als bei der Aufnahme eines entscheidenden Moments geht es bei der Langzeitbelichtungsfotografie um sorgfältige Planung und methodisches Experimentieren, um einen bestimmten Effekt des Bildes zu erhalten.
Alle Bilder in diesem Artikel stehen unter einer CC BY-NC 4.0 Lizenz.